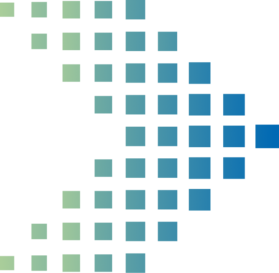Die Bundesregierung legt mit der Industriestrategie 2035 ein Bekenntnis zum Standort ab, das die richtige Ambition zeigt, aber an der Zeitachse der Realität zu scheitern droht. In einer Phase anhaltender konjunktureller Schwäche können wir uns mit Lösungen für 2027 keine Zeit kaufen. Eine Analyse zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Ein Kommentar von IV-Tirol-Geschäftsführer Michael Mairhofer
Es ist ein Dokument, auf das die Industrie lange gewartet hat. Mit der „Industriestrategie 2035“ definiert die Bundesregierung erstmals seit Jahren wieder einen klaren Anspruch: Österreich soll zurück unter die Top-10 der Industrienationen. Diese Zielsetzung ist kein bloßes Wunschdenken, sondern die unverhandelbare Voraussetzung, um unser Sozialmodell und unseren Wohlstand auch für die nächste Generation zu sichern. Dass die Politik anerkennt, dass Wertschöpfung nicht vom Himmel fällt, sondern in Werkshallen erarbeitet wird, ist ein kultureller Fortschritt. Die Diagnose im 112 Seiten starken Papier ist präzise: Wir haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren, die Kosten sind zu hoch, die Bürokratie zu dicht. Doch wer die vorgeschlagene Therapie auf ihre Wirkung in der aktuellen Phase prüft, in der echtes Wachstum und ein merklicher wirtschaftlicher Aufschwung auf sich warten lassen, stößt auf eine gefährliche Lücke zwischen der ökonomischen Dringlichkeit und dem politischen Zeitplan.
Das Zeit-Paradoxon der Standortpolitik
Wir haben zwar die technische Rezession hinter uns, bewegen uns aber bestenfalls in einer Seitwärtsbewegung. Die Auftragsbücher füllen sich nur zögerlich, der Margendruck ist enorm. Die Strategie antwortet auf diesen unmittelbaren Druck mit einem Zeitplan, der gelinde gesagt als gemütlich bezeichnet werden kann. Zentrale Entlastungsmaßnahmen sollen mehrheitlich erst 2027 greifen. Auch die Senkung der Lohnnebenkosten wird vage für die „Mitte der Regierungsperiode“ in Aussicht gestellt.
Hier liegt der fundamentale Denkfehler: Ein Standortwettbewerb kennt keine Pausentaste. Wenn Unternehmen heute entscheiden müssen, ob sie in Tirol investieren oder Produktionskapazitäten zu unseren kostengünstigeren EU-Nachbarn wie Tschechien oder Slowenien verlagern, hilft ihnen ein versprochener Vorteil in zwei Jahren nicht. Eine Strategie, die ihre Wirkung erst entfaltet, wenn Entscheidungen längst gefallen sind, verfehlt ihren operativen Zweck. Der Standort braucht keine Placebos für die Zukunft, sondern echten finanziellen Spielraum im Hier und Jetzt.
Asymmetrie der Mittel
Asymmetrie der Mittel Besonders evident wird die Diskrepanz zwischen Problemgröße und Lösungsansatz beim Thema Energie. Wir operieren hier nicht im luftleeren Raum, sondern stehen im direkten Wettbewerb mit Deutschland. Unser wichtigster Handelspartner ist bei Industriegütern zugleich einer unserer schärfsten Mitbewerber – und er schafft Fakten: Berlin mobilisiert allein für das Jahr 2026 ein Rekordvolumen von 29,5 Milliarden Euro, um das Strompreisniveau zu dämpfen. Das Erfolgsrezept des Nachbarn ist ein radikaler Systemwechsel: Der Staat nimmt die Kosten der Energiewende von der Stromrechnung. Konkret wandern die 14,6 Milliarden Euro für die EEG-Finanzierung – also jene Kosten für den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, die früher als massiver Kostenblock die Bilanzen der Produktionsbetriebe belasteten – direkt ins staatliche Budget. Dazu kommen weitere 6,5 Milliarden Euro zur Dämpfung der Netzentgelte.
Österreich reagiert darauf zwar, aber die Relationen stimmen nicht: Dem deutschen Modell, das die Industrie massiv von Infrastruktur-Lasten befreit, stellen wir einen Industriestrompreis mit einem Volumen von 250 Millionen Euro entgegen. Man muss diese Zahlen nüchtern einordnen: 29,5 Milliarden dort, 250 Millionen hier. Im europäischen Kontext ist unsere Lösung eine homöopathische Dosis für eine Krankheit, die eine Notoperation erfordert. Die Tiroler Industrie fordert keine Dauersubventionen, aber sie benötigt faire Wettbewerbsbedingungen. Wenn unser direkter Nachbar die Systemkosten vom Finanzminister zahlen lässt, reicht ein symbolischer Schirm in Österreich nicht aus, um Investitionen und Wertschöpfung langfristig im Land zu halten.
Strategie unter Vorbehalt
Jede Strategie ist am Ende nur so stark wie ihr finanzielles Fundament. Und genau hier offenbart das Papier seine größte Schwäche. Viele der angekündigten Maßnahmen stehen unter einem „allgemeinen Budgetvorbehalt“. Das Problem dabei ist nicht nur buchhalterischer Natur – es ist eine Frage der Prioritäten. Wer die Industrie entlasten will, muss den Mut haben, an anderer Stelle Lasten abzuwerfen. Das Papier listet 114 Maßnahmen auf, schweigt sich aber über die großen Strukturreformen weitgehend aus. Wir leisten uns nach wie vor Doppelgleisigkeiten zwischen Bund und Ländern und einen Verwaltungsapparat, der Ressourcen bindet, die wir dringend für Innovationen bräuchten. Ohne den Mut, diese ineffizienten Strukturen aufzubrechen, bleiben die versprochenen Entlastungen ein ungedeckter Scheck. Echte Standortpolitik heißt, den Staat so aufzustellen, dass er Investitionen ermöglicht, statt sie durch hohe Kosten zu verhindern.
Vorfahrt für die Umsetzung
Nichtsdestotrotz enthält die Industriestrategie der Bundesregierung richtige Ansätze, etwa im Bereich der Schlüsseltechnologien, wo Tirol mit Stärkefeldern wie Life-Sciences oder Quantentechnologie exzellent aufgestellt ist. Doch Papier ist geduldig – der Weltmarkt ist es nicht. Der Erfolg der Industriestrategie 2035 wird sich nicht an den gedruckten Seiten messen, sondern einzig daran, ob es gelingt, die Maßnahmen zeitlich massiv vorzuziehen. Wir können nicht bis 2027 warten, um wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn wir die wertschöpfende Substanz unserer Wirtschaft heute verlieren, fehlen uns 2035 die Fundamente für den Wiederaufstieg. Das Ziel stimmt, jetzt muss aufs Tempo gedrückt werden.