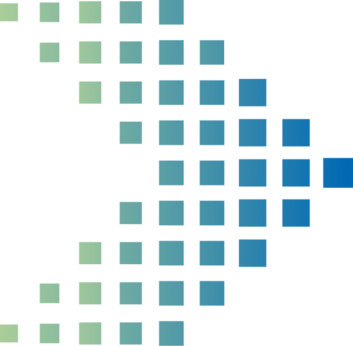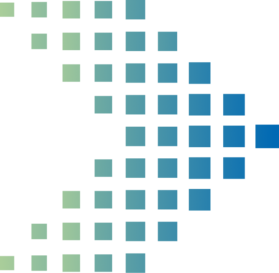Zuerst einmal die gute Nachricht: Österreichs Wirtschaft wächst wieder – auch wenn es nur ein Miniwachstum ist. Doch während die Prognosen leicht nach oben zeigen, kämpfen viele Industriebetriebe nach wie vor mit Auftragsrückgängen, Kostenexplosionen und Standortzweifeln. Von Entwarnung kann also keine Rede sein.
Kommentar von Michael Mairhofer, Geschäftsführer der IV Tirol
Nach drei Jahren Industrierezession und zwei Jahren gesamtwirtschaftlicher Konjunkturflaute melden WIFO und IHS für 2025 erstmals wieder ein moderates Wachstum. Das reale BIP soll heuer um 0,8 bis 1 Prozent steigen. Für 2026 wird ein ähnlicher Verlauf prognostiziert. Doch wer jetzt gleich in Jubel ausbricht, sollte etwas genauer hinschauen. Denn für eine nachhaltige Trendwende der Industrie – dem Wohlstands- und Wachstumsmotor Nummer eins im Land – muss die Politik zuerst ihre Hausaufgaben machen. Sonst drohen weitere verlorene Jahre der Stagnation, in denen wir weiter Marktanteile und Wertschöpfung einbüßen.
Laut aktuellem EY-Industriebarometer ist der produzierende Bereich im zweiten Quartal 2025 das neunte Quartal in Folge geschrumpft. Die Umsätze gingen um 0,9 Prozent zurück, die Exporte um 3 Prozent. Fast 20.000 Industriearbeitsplätze sind im Jahresvergleich verloren gegangen – in Tirol allein rund 2.500 seit 2023. Diese Entwicklung ist keine temporäre Schwächephase mehr, sondern ein struktureller Substanzverlust, der an den Fundamenten unseres Industriestandorts nagt.
Wettbewerbsfähigkeit braucht Verlässlichkeit
Die heimische Industrie steht nicht still – sie stemmt sich gegen die immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen. Doch sie verliert an Boden, weil zentrale Standortfaktoren nicht mehr stimmen: Die Lohnstückkosten zählen zu den höchsten in Europa, die Energiepreise – insbesondere für Gas – liegen deutlich über dem Vorkrisenniveau. Und bei den Investitionen zeigt sich ein alarmierender Trend: Während heimische Betriebe über viele Jahre hinweg überdurchschnittlich viel in moderne Produktionsanlagen investiert haben, geraten sie seit 2023 merklich ins Hintertreffen. Der technologische Vorsprung, der Österreichs Industriebetrieben lange Zeit einen Vorteil im Konkurrenzkampf mit anderem europäischen Mitbewerb verschafft hat, schmilzt zusehends dahin – mit direkten Folgen für Produktivität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Die hohe Produktivität war lange einer unserer entscheidenden Standortvorteile. Doch dieser Vorsprung lässt sich nur halten, wenn sich Investitionen lohnen. Genau das wird immer schwieriger: Die Arbeitskosten steigen, die regulatorischen Anforderungen nehmen zu, der unternehmerische Gestaltungsspielraum – und vor allem die Ertragsmöglichkeiten – schrumpfen.
Kosten steigen, Arbeitszeit sinkt – das gefährdet unseren Wohlstand
Strukturelle Negativtrends verschärfen die Lage weiter: Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit pro Beschäftigtem ist in Österreich von 1.814 Stunden (1995) auf nur noch 1.529 Stunden (2025) gesunken – ein Rückgang von fast 16 Prozent. Gleichzeitig steigen die Belastungen bei Steuern, Energie und Bürokratie weiter. Das passt nicht zusammen. Der Exportüberschuss ist Geschichte. Aufgrund der angeschlagenen internationalen Wettbewerbsfähigkeit rutscht die österreichische Handelsbilanz ins Minus – zuletzt belief sich das Defizit auf 5,35 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines realen Verlusts an Konkurrenzfähigkeit. Und das, obwohl Österreichs Industrie weiterhin zu den innovationsstärksten Europas zählt – aber am Markt zählt nun mal vor allem der Preis.
Was jetzt zählt: Entschlossene Entlastungsschritte
Industrielle Wertschöpfung entsteht nicht von selbst. Sie ist das Ergebnis guter Rahmenbedingungen, verlässlicher Politik und konsequenter Weiterentwicklung des Standorts. Wenn wir jetzt nicht mit entschlossenen Entlastungsschritten gegensteuern, riskieren wir, dass Österreich im globalen Wettbewerb weiter an Boden verliert. Was die Industrie braucht, ist kein Appell zur Geduld, sondern eine Standortpolitik, die entschlossen handelt, Investitionen ermöglicht und wirtschaftliche Substanz wieder stärkt.
Arbeitskosten senken: Mit durchschnittlichen Arbeitskosten von 44,5 Euro pro Stunde zählt Österreich zu den teuersten Industriestandorten Europas. Die IV Tirol fordert daher eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten – um Investitionen zu ermöglichen, Beschäftigung zu sichern und Innovationskraft zu stärken. Zugleich braucht es in den kommenden Jahren weiter maßvolle Lohnabschlüsse unterhalb der Inflation, um die Ertragslage der Betriebe zu stabilisieren und den Abstand bei den Lohnstückkosten zu anderen EU-Standorten schrittweise zu verringern.
Energiepreise planbar machen: Die Strompreiskompensation bis 2026 war ein wichtiger Schritt – doch sie reicht nicht aus. Die Industrie braucht Planungssicherheit bis 2030, um Investitionen abzusichern und Produktion in Österreich zu halten. Besonders Gas bleibt im internationalen Vergleich deutlich teurer – rund viermal so hoch wie in den USA. Für Tirol ist klar: Der Ausbau der Wasserkraft ist der wirksamste Hebel für eine verlässliche, saubere und langfristig leistbare Energieversorgung. Nur mit klarer Perspektive können vor allem energieintensive Industrieunternehmen wettbewerbsfähig bleiben.
Bürokratie abbauen: Im Rahmen des „Tirol Konvent“ startet Anfang 2026 eine neue digitale Verfahrensplattform – eine gemeinsame Initiative des Landes Tirol und der IV Tirol –, die Planungsprozesse vereinfacht, Genehmigungen beschleunigt und Verwaltung digitalisiert. Die Potenziale sind enorm: Laut einer Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung verursacht Bürokratie in Tirol jährlich rund 52 Millionen Euro an Zusatzkosten – das entspricht 0,2 Prozent der gesamten regionalen Wirtschaftsleistung. Das können und dürfen wir uns nicht mehr leisten. Der Tirol Konvent ist daher nicht nur ein regionales Leuchtturmprojekt, sondern ein Modell, wie ganz Österreich Bürokratie wirksam abbauen und Verfahren neu denken kann, wenn die Umsetzung im Sinne der Unternehmen erfolgt. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung, es ist Reform- und Umsetzungswillen vorhanden, aber am Ende zählen die Ergebnisse.
Jetzt ist der Moment, um nicht nur auf den nächsten Aufschwung zu hoffen, sondern ihn durch sinkende Standortkosten, verlässliche Energiepolitik und moderne, digitale Verfahren aktiv möglich zu machen.