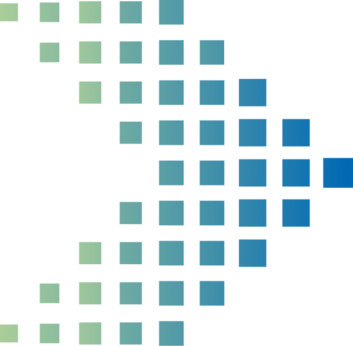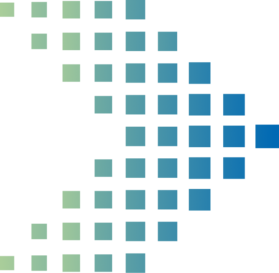Am 30. September präsentierten die RLB Tirol und die IV Tirol bei der Wirtschaftsprognose 2026 einen verhalten positiven Ausblick: Nach drei Jahren Rezession erwartet Raiffeisen-Research-Chefökonom Gunter Deuber 1,0 % BIP-Wachstum. Für einen nachhaltigen Aufschwung braucht es aber eine klare wirtschaftspolitische Strategie.
Bei der Wirtschaftsprognose 2026 – dieses Jahr zum ersten Mal gemeinschaftlich organisiert von der Raiffeisen-Landesbank Tirol und der IV Tirol – wurde deutlich: Die Talsohle ist durchschritten. Doch ohne klare Maßnahmen zur Stärkung von Produktivität, Investitionen und Standortqualität bleibt der Aufschwung fragil. Raiffeisen-Research-Chefökonom Gunter Deuber skizzierte eine verhalten optimistische Perspektive: Nach der längsten Rezession der Nachkriegszeit sei 2026 ein Wachstum von rund einem Prozent realistisch – „kein Aufschwung, aber ein möglicher Neustart“. Österreichs Wirtschaft befinde sich an einem Wendepunkt, so Deuber: „Die Erholung kommt – aber sie wird mühsam.“ Besonders kritisch bewertete Deuber die strukturellen Schwächen des Standorts. Die Schere zwischen steigenden Arbeitskosten und sinkenden Erträgen öffne sich weiter; in kaum einem anderen EU-Land sei der Abstand so groß. Während die Arbeitskosten kräftig steigen, stagniert die Produktivität – nach jahrzehntelangen Effizienzgewinnen erstmals mit rückläufiger Tendenz. Für Deuber ein Warnsignal: Wenn Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit nicht gestärkt werden, drohe Österreich im europäischen Vergleich dauerhaft zurückzufallen.
Tirols Industrie unter Druck
Einen regionalen Blick auf die Entwicklung des Industriestandorts Tirol warf Ökonom Stefan Haigner von der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW), der im Auftrag der IV Tirol die Standortentwicklung seit Beginn der Industrierezession analysierte. Seine Analyse zeigt: Auch in Tirol ist die industrielle Beschäftigung in den letzten zwei Jahren um rund 2.500 Arbeitsplätze zurückgegangen – ein eindeutiges Anzeichen für die anhaltende Schwäche der Industrie. Haigner identifizierte drei zentrale Wettbewerbsbremsen: hohe Abgaben auf Arbeit, weiterhin überdurchschnittliche Energiepreise trotz bestehender Kompensationsmaßnahmen sowie eine ausgeprägte Bürokratiebelastung. Laut Berechnungen der GAW verursacht diese allein in Tirol rund 52 Millionen Euro Zusatzkosten pro Jahr – ein Wachstumshemmnis von rund 0,2 Prozentpunkten der regionalen Wirtschaftsleistung. „Die Wettbewerbsfähigkeit Tirols hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, diese strukturellen Hürden konsequent abzubauen“, so Haigner. Eine zukunftsorientierte Industriepolitik müsse aus seiner Sicht vor allem auf Investitionen, Innovation und Planbarkeit setzen.
Kurskorrektur dringend erforderlich
Auch IV-Tirol-Geschäftsführer Michael Mairhofer betonte die Notwendigkeit einer wirtschaftspolitischen Kurskorrektur. „Die Tiroler Industrie hat enorme Resilienz bewiesen – doch ohne strukturelle Entlastung bleibt das Potenzial einer echten Erholung begrenzt.“ Nach Jahren explodierender Lohnstückkosten brauche es eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, um den Betrieben wieder Luft zum Atmen zu geben. Der aktuelle Metaller-KV unterhalb der Inflationsrate sei ein erster wichtiger Schritt, könne aber erst der Anfang eines notwendigen Paradigmenwechsels bei den Lohnverhandlungen der kommenden Jahre sein.
Energiepreise und Entbürokratisierung als Schlüssel
Auch beim Thema Energie forderte Mairhofer langfristige Planungssicherheit. Die Strompreiskompensation bis 2026 verschaffe den energieintensiven Betrieben zwar kurzfristige Stabilität, doch entscheidend sei der Blick nach vorn. „Österreich muss wieder zu einem Land mit wettbewerbsfähigen Strompreisen werden. Ein Industriestrompreis, wie ihn viele europäische Länder bereits eingeführt haben, würde die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe stärken und Investitionen in die Transformation absichern.“ Der Ausbau der Wasserkraft müsse dabei entschlossen vorangetrieben werden – „sie ist unser stärkster Hebel für eine sichere, nachhaltige Energieversorgung und die industrielle Zukunft Tirols.“ Als dritten Schlüssel für einen zukunftsfähigen Standort nannte Mairhofer den Abbau bürokratischer Hürden. Mit dem Tirol Konvent geht die IV Tirol gemeinsam mit dem Land Tirol und der WK Tirol neue Wege, um Genehmigungsverfahren zu digitalisieren und zu beschleunigen. Das Projekt, das 2026 in den Pilotbetrieb startet, soll Verwaltung und Wirtschaft enger verzahnen. Für Mairhofer steht jedoch fest, dass der Erfolg des Tirol Konvents von der Entwicklungsbereitschaft der handelnden Personen in den Amtstuben abhängt: „Ohne ein neues Amtsverständnis wird das Projekt scheitern. Es braucht eine Verwaltung, die wirtschaftsfreundlich denkt, kooperativ handelt und Projekte ermöglicht – nicht eine, die sie verzögert.“